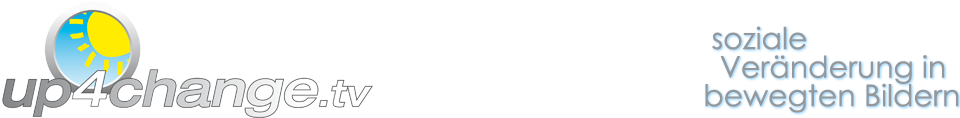Stolze junge Männer in pinkfarbenen Umhängen. Die Haare – sorgfältig geflochten zu sehr kleinen langen Zöpfen – wirken wie ein Helm, was vielleicht an dem Schlamm aus rötlichem Ocker liegt, der diese unnatürliche Festigkeit schafft.
Stolze junge Männer in pinkfarbenen Umhängen. Die Haare – sorgfältig geflochten zu sehr kleinen langen Zöpfen – wirken wie ein Helm, was vielleicht an dem Schlamm aus rötlichem Ocker liegt, der diese unnatürliche Festigkeit schafft.
Hätte ich mich gewundert, wenn ihre Haut einen avatar-mäßig, bläulich-violetten Schimmer gehabt hätten? So kamen sie mir bei meiner ersten Begegnung vor, irgendwie fremd wie die Bewohner des Cameron´schen Universums.
Ich hatte mich während der stundenlangen Fahrt durch die Halbwüste gefragt, wie man hier überleben könne. Dabei ging es mir nicht um zeitnahe Bilder vom Fußball oder, ob das Internet schnell genug sei. Ich fragte mich vielmehr, wie man hier ohne eigenen Brunnen, ohne Stromversorgung, ohne geländegängies Fahrzeug, ohne solides Haus existieren kann. Wahrscheinlich hatten sich die Briten als Kolonialherren Ähnliches gefragt und ihre Antwort fiel eindeutig aus. Nein, hier kann „man“ nicht leben. Eher schon in Nanyuki oder Nairobi mit deutlich angenehmeren Temperaturen, einfacher Wasserversorgung und einer Bahnverbindung.
Das ist bis heute das Glück der Menschen im Norden Kenias. Das semi-aride Klima, die fehlenden Attraktionen (Löwen, Elefanten, etc) bewahrten die Nomaden der Samburo, Rendille, Turkana, etc. vor dem Zugriff der Kolonialisten und später der Touristen. Die einzig funktionierende Struktur in diesem Teil Kenias scheinen die Missionare mit ihren Kirchen, Schulen, Kliniken, aber auch mit ihrem Funknetz und ihrer „Fluglinie“ zu sein.
 Soviel zu unserem Blickwinkel. Wie sehen die jungen Krieger ihr Leben? Das hat uns unser Protagonist, Lekuren Mirgichan, erzählt:
Soviel zu unserem Blickwinkel. Wie sehen die jungen Krieger ihr Leben? Das hat uns unser Protagonist, Lekuren Mirgichan, erzählt:
Ich bin ein junger Krieger – ein Moran – und besitze nur wenig Tiere. Ich lebe mit meinen sechs Schwestern und fünf Brüdern im Dorf Sakardala. Weil wird mit unseren Hütten näher an die Stadt Laisamis gezogen sind können heute meine jüngeren Geschwister zur Schule gehen.
Ich bin nach meiner Beschneidung – wie alle anderen jungen Männer hier im Dorf – Moran geworden. Wir sind als junge Krieger für die Tierhaltung, die Sicherheit im Dorf und in den Weidegebieten verantwortlich. Jetzt, wo es so trocken ist, sind wir mit unseren Tieren in Weidegebiete gezogen, die weit entfernt von Sarkadala liegen. Im Dorf bleiben ein paar Ziegen, Schafe und Kamele, um die Kinder und Erwachsenen mit Milch zu versorgen.
Wir leben jetzt in Sirirwa. Hier haben wir kein festes zu Hause und ziehen häufig um.
Mein Vater hat seine Tiere unter seinen Kindern verteilt, so besitzen einige 5 andere 10 Tiere. Eine Familie braucht mindestens 100 Tiere um überleben zu können. Wenn nämlich eine schlimme Dürre anbricht, kannst Du die Hälfte deiner Tiere verkaufen, einige müssten sterben, aber es reicht immer noch für uns zum Überleben.
Während normaler Jahreszeiten können wir gut überleben, aber mit den Dürren kommen Krankheiten und unsere Tiere sterben. Normalerweise wissen wir, dass es im April und im Dezember regnet. Aber heute kann das niemand mehr vorhersagen.
Vor zwei Jahren hatte wir Streit mit den Boranas und den Somalis. Die Dürre führte dazu, dass sich die verschiedenen Herden ein Weidegebiet und eine Wasserstelle teilen mussten. Die Dürre führte also dazu, dass wir uns um Weideland und Wasser stritten, obwohl wir eigentlich friedlich sind.
Niemand von der Regierung hat uns vor der schlimmen Dürre und dem Klimawandel gewarnt.
Das Leben in der Stadt bietet viele Möglichkeiten. Wir aber leben von der Viehhaltung. Wir können unsere Tiere nicht in die Stadt zum Grasen treiben, wir müssen mit ihnen hier auf den Weiden bleiben, um Wasser und Futter für sie zu suchen. So können wir nicht am modernen Leben teilnehmen.
Als Viehhalter ist es ganz schwierig, einen Job zum Geld verdienen zu bekommen. Die Leute in der Stadt lehnen uns ab. Uns bleibt gar nichts anderes übrig als uns auf die Tierhaltung zu konzentrieren.
Wir brauchen Leute, die uns rechtzeitig über kommende Dürreperioden informieren. Wir brauchen Unterstützung, mit der Dürre besser klar zu kommen. Natürlich brauchen wir regelmäßiger Impfungen und Medikamente für unsere Tiere. Vor allem während der Dürreperioden ist das Vieh anfällig für alle möglichen Krankheiten.
Hier in dem einsamen Weidegebiet wissen wir nicht, was draußen passiert. Manchmal fühlen wir uns verloren und trotzdem sind wir mit unserem Leben glücklich.
Uli Schwarz und Petra Dilthey